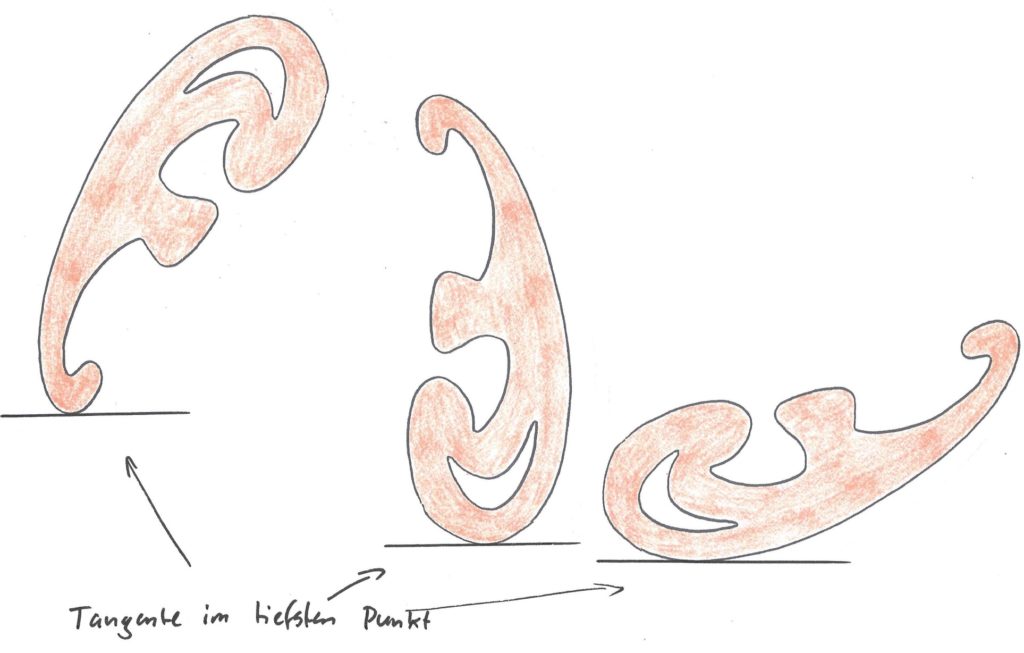Ich habe gerade das Bedürfnis, mal eine Art Rant zu schreiben. Vielleicht nicht zu 100% on-topic, aber da mir das Thema in letzter Zeit immer und immer wieder begegnet, möchte ich hier einfach mal Dampf ablassen.
Es geht um die (bereits im Blogbeitrag „Intuition – zwischen den Extremen“ angesprochenen) Extrempositionen, die nach meinem Empfinden mittlerweile so gut wie jede Diskussion dominieren. Einige Beispiele aus dem thematischen Umfeld dieses Blogs:
- Im Buch „Teaching Minds“ von Roger Schank (siehe auch im Blogeintrag „Programmieren als Denktraining„) vertritt der Autor die These, dass es eigentlich die wichtigste Aufgabe von Schule und Hochschule sein sollte, jungen Menschen das selbständige Denken beizubringen. Dem würde ich unbedingt zustimmen, doch dann kippt der Autor das Kind mit dem Bade aus: Das faktenbasierte Lernen gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte, und überhaupt lernten Menschen nur das, wofür sie intrinsisch motiviert sind. Ganz ehrlich: Wenn jeder nur das lernen würde, worauf er Lust hat, wie viele Menschen könnten dann lesen und schreiben? Und braucht es nicht auch ein Grundgerüst aus Faktenwissen, um über etwas nachdenken zu können? Ja, um überhaupt erkennen zu können, was von Interesse sein könnte? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Mischformen zu finden, in denen faktenbasiertes Lernen mit „Denken lernen“ zu einem sinnvollen Ganzen vereinigt wird?
- Vor einigen Wochen war ich in einer Kurzeinführung zum Thema „Flipped Classroom“. Diese Lehrmethode geht davon aus, dass es sinnvoller ist, wenn Studierende sich das Faktenwissen bereits vor dem Unterricht aneignen und dass im Mittelpunkt des gemeinsamen Lernens das betreute Üben und Anwenden dieses Faktenwissens steht. Dieser Ansatz ist die genaue Umkehrung des klassischen Lehrens an Hochschulen, wo die Faktenvermittlung per Vorlesung und das Einüben daheim erfolgt. Aber beides sind erneut Extrempositionen – im Alltag an einer HAW unterrichten viele Kollegen erfolgreich mit Mischformen, bei denen im Unterricht sowohl das Vermitteln von Fakten und das aktive Arbeiten damit stattfindet. Und meines Wissens funktioniert diese Art zu lehren sehr gut und wird auch von den Studierenden oft so gefordert – aber weil sie nicht so extrem ist, ist sie in der didaktischen Diskussion nicht so präsent.
- Sobald die Diskussion auf das Thema „Künstliche Intelligenz“ kommt, erleben wir ebenfalls eine deutliche Polarisierung. Diejenigen, die Freude am Forschen haben oder eine Chance auf eine Karriere darin sehen, bauen ohne jedwede moralische Hemmschwelle Systeme, die ethisch mehr als fragwürdig sind. Und die Besorgten schreiben Buch um Buch darüber, wie das Aufkommen der KI den Untergang des selbständigen Denkens, des Arbeitsmarktes und überhaupt des westlichen Abendlandes darstellen wird.
Ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Digitale Lehre, soziale Medien, Transhumanismus, Open Source, Blockchain – überall wird die Diskussion von idealistischen Zukunftsgläubigen auf der einen und Weltuntergangspropheten auf der anderen Seite dominiert. Zwar suchen (und finden) die Pragmatiker – die nach meiner Erfahrung die breite Mehrheit stellen – beständig Mittelwege und Kompromisse zwischen den Extrema, aber in der öffentlichen Diskussion kommen sie kaum vor. Klar, denn für eine Mittelposition muss man deutlich mehr wissen, deutlich differenzierter betrachten und auch deutlich mehr abwägen als für ein entschiedenes „Ja“ oder „Nein“ ohne Wenn und Aber.
Mir wäre es wichtig, dass wir uns dieser Fokussierung auf Extrempositionen bewusst werden, denn wir erleben sie derzeit auch im Alltag an allen Ecken und Enden. „Alle Migranten aufnehmen“ steht einem kompromisslosen „Ausländer raus“ gegenüber. „Es kann keine Gleichheit geben, bevor nicht die gesamte Sprache gegendert ist“ prallt ungebremst auf „Gendering sollte gesetzlich verboten werden“. „Vegetarier sind immer noch Mörder, nur strikte Veganer sind gute Menschen“ ist meilenweit entfernt von „Finger weg von meinem Steak, und das Kilo darf höchstens 10 € kosten“. Man bekommt so das Gefühl, dass Kompromisse oder schrittweise Verbesserungen gar nicht möglich oder gewollt sind, stattdessen versucht jede Extremposition, so viele Anhänger wie möglich um sich zu scharen und sich als die Besitzer der einzigen Wahrheit (oder als die einzig Guten) darzustellen.
Nun ist Politik eigentlich nicht nicht das Thema dieses Blogs, aber Wissenschaft und Lehre sind es. Und da reagiere ich zunehmend genervt, wenn mir wieder und wieder irgendwelche Extrempositionen – möglichst noch garniert mit absolutem Wahrheits- oder sogar religiösem Erweckungsanspruch – serviert werden. Wissenschaft sollte der Suche nach der Wahrheit verpflichtet sein, und die Wahrheit ist (speziell bei gesellschaftlichen Themen) fast immer kompliziert. Sie lässt sich für gewöhnlich weder mit einigen wenigen markanten Thesen beschreiben, noch waren all die anderen da draußen jahrzehntelang zu blöd, sie zu erkennen. Wer überzeugt ist, im alleinigen Besitz der Erkenntnis zu sein, sagt damit mehr über sich aus als über die Erkenntnis an sich.
Wahren Wissenschaftler bleiben neugierig, hören einander zu, versuchen alle Seiten zu verstehen. Und sie sind bereit, ihre Überzeugungen und Lehrmeinungen regelmäßig auf den Prüfstand zu heben und gegebenenfalls anzupassen. Aber Hand aufs Herz: Wie viele Lehrer, Dozenten und Professoren, die wir selbst in unserer akademischen Laufbahn erleben durften, haben diesen Eindruck erweckt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die meisten Lehrenden den Saal betreten mit dem Anspruch, jetzt die WahrheitTM zu verkünden, und dass die meisten Lernenden auch genau das von ihnen erwarten?
Wenn ich so darüber nachdenke, müssen wir vielleicht gar nicht so weit suchen, um Gründe für die Dominanz einfacher, mit Überzeugung vorgetragener Lehrsätze zu finden…? Nein, natürlich gibt es dafür eine Vielzahl von Gründen, aber wenn ich die meisten davon ignoriere, mich auf eine einzige Ursache konzentriere, diese in einem halben Dutzend Thesen zuspitze und mit einem Schwung anschaulicher Anekdoten unterfüttere, kann ich damit sicherlich ein einigermaßen erfolgreiches Buch schreiben und es vielleicht sogar bis in die Talkshows schaffen…